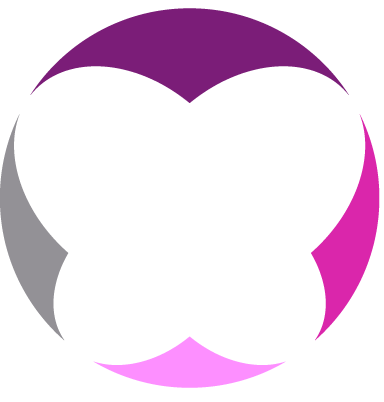Ein kleines, unscheinbares, 25g leichtes, aber immens wichtiges Organ in der Form eines Schmetterlings – das ist die Schilddrüse. Sie nimmt eine zentrale Stellung für die Regulierung des menschlichen Stoffwechsels ein und beeinflusst auch das seelische Gleichgewicht. Deshalb wird die Schilddrüse gerne auch als Sitz der Seele oder als Spiegel der Emotionen bezeichnet.
Kleines, hochkomplexes Organ mit großer Wirkung
Die Schilddrüse liegt im vorderen, unteren Halsbereich in der Nähe des Kehlkopfes. Sie reguliert über die Ausschüttung von etwa 30 Hormonen die Aktivität anderer Hormondrüsen im Körper, wie bspw. Hirnanhangsdrüse, Zirbeldrüse, Nebennieren und Geschlechtsdrüsen.
Als Schaltzentrale in der hochkomplexen Kommunikation aus etwa 1000 Botenstoffen und sieben bedeutenden Hormondrüsen in unserem Körper nimmt die Schilddrüse eine Sonderstellung ein. Übrigens: Von den 1000 Botenstoffen ist nur jeder zehnte bisher halbwegs erforscht. Das bedeutet, bei über 90 Prozent der Botenstoffe weiß man nur wenig über ihr komplexes und fein austariertes Zusammenspiel.
Die Hormone, die in der Schilddrüse produziert werden, steuern bspw. unseren Energieverbrauch, das Herz-Kreislauf-System, den Stoffwechsel, die Verdauung, den Tag-Nacht-Rhythmus, die Muskelaktivität, die Nervenzellen, den Gefühlshaushalt, die Sexualität oder die Fruchtbarkeit. Auf Grund ihres Einflusses auf den Stoffwechsel der Nervenzellen und die Gehirnaktivität wirken sich Probleme und Erkrankungen der Schilddrüse häufig auf die Psyche und das emotionale Befinden aus.
Wie funktioniert die Schilddrüse?
Insgesamt produziert die Schilddrüse 30 Hormone. Zu den bekanntesten zählen T1, T2, T3, T4 und Calcitonin. Dabei ist Thyroxin, auch als T4 bekannt, das Haupthormon, das die Schilddrüse produziert. Dieses Hormon hat vier Jod-Atome, deshalb auch T4. Die Schilddrüse produziert dieses Hormon aber nur auf ein Signal der Hirnanhangdrüse, das diese in Form von TSH (Thyroid Stimulating Hormone) sendet.
Die Hirnanhangdrüse funktioniert dabei vereinfacht gesagt wie das Thermostat einer Heizung, das den T4-Gehalt misst. Ist dieser zu niedrig, sendet sie TSH an die Schilddrüse, die wie die dazugehörige Heizung funktioniert und die Produktion von T4 hochfährt.
Außerdem produziert die Schilddrüse noch in geringeren Mengen T3, die Abkürzung für Triiodthyronin, das drei Jod-Atome enthält. T3 wird vor allem aus T4 hergestellt und verrichtet die eigentliche Arbeit in den Zellen. Etwa 20 Prozent des T4 wird im Darm in T3 umgewandelt. Voraussetzung dafür ist allerdings eine gesunde Darmflora. Daher können sich bspw. Symptome eine Schilddrüsen-Unterfunktion entwickeln, wenn die Darmflora und damit die Umwandlung von T4 in T3 gestört ist.
Häufig wird einem die Wichtigkeit der Schilddrüse erst bewusst, wenn sie nicht mehr richtig funktioniert und gesundheitliche Probleme auftreten. So können verschiedene Begleitumstände, die oft erhebliche Beschwerden verursachen, mit der Schilddrüse verknüpft sein:
- Schilddrüsenunterfunktion
- Entzündung
- Hashimoto Thyreoiditis
- Eisenmangel (sehr, sehr häufig!)
- Histamin-Unverträglichkeit
- Progesteron-Mangel
- HPU/KPU: Nährstoffmangel an Zink, Selen, Vitamin-B-Komplex
- Schlechte Folsäure-Verwertung (MTHFR)